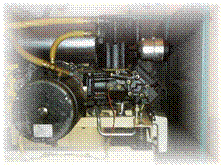Energie
Energie-Verschwendung und -Entsorgung
Kostenlose Energie und ihre sinnvolle
Nutzung
Aktualisiert: 2024-02-26
Themen auf dieser Seite:
- entsorgte Energie - ein Geschenk wird einfach
weggeworfen!
-
Großkraftwerke sind die größten Energieverschwender
- Halbierung der CO2 -Emissionen bei
der Energie-Versorgung wäre sofort möglich
- Kühltürme
sind unverantwortlich!!!
- Kernfusion
und Moderne Großkraftwerke sind auch nicht besser - und völlig überflüssig
- Energiesparen
durch vernünftiges Bauen und Wohnen
Nachdem Greta Thunberg im
Jahr 2019 der Weltöffentlichkeit endlich bewusst gemacht hat, dass Maßnahmen
gegen den voranschreitenden Klimawandel keinen Aufschub mehr dulden, wurden in
Deutschland lange überfällige Veränderungen angestoßen, die zwar dringend nötig
sind, aber eine viel zu lange Vorlaufzeit haben, bis sie tatsächlich
positive Wirkung auf das Klima entfalten. Schon viele Jahrzehnte früher und
auch jetzt noch wären Sofort-Maßnahmen dringend nötig und ohne Weiteres
möglich, die Energie-Einsparungen in riesigen Ausmaßen ermöglichen, ohne dass
neue Techniken entwickelt werden müssen, ohne drohenden Verlust von
Arbeitsplätzen und ganzen Industrie-Zweigen. Vieles davon wäre auch als
Brückentechnologie hilfreich, um Energie sinnvoller und effizienter zu nutzen
und die CO2-Emissionen sofort signifikant zu senken!
Beispiel Stromerzeugung:
CO2-Emissionen halbieren, Energie sparen, Kernkraftwerke überflüssig
machen, Kosten senken? Alles gleichzeitig ginge nicht, wird von verschiedenen Seiten immer
behauptet. Tatsächlich ist in diesem Bereichen vieles
machbar.
Die größten Energie-Verschwender sind Großkraftwerke
mit Kühltürmen.
Solche
Kraftwerke sind in erster Linie Heizungen.
Sie produzieren systembedingt deutlich mehr Wärme-Energie
als elektrische Energie. Nur weil sie eben Strom liefern sollen, wird die
wertvolle Wärmeenergie in unvorstellbar großem Ausmaß entsorgt.
Diese Entsorgungs-Aufgabe übernehmen die Kühltürme: Sie geben über die Hälfte der im Kraftwerk
gewonnenen Energie direkt an die Umwelt ab! Die weißen Dampfwolken, die
wie aus einem riesigen Kochtopf oben herausquellen, bestehen zwar nur aus
„harmlosem“ Wasserdampf; aber um die mehreren Tausend Liter Wasser pro Sekunde
zu verdampfen, wird mehr Energie eingesetzt, als letztlich in Form von
elektrischer Energie ins Netz eingespeist wird. Deshalb ist der Ausstoß von CO2
(und anderen Schadstoffen) durch den neben dem Kühlturm stehenden Schornstein
entsprechend hoch (und beim Kernkraftwerk die Menge der radioaktiver
Abfälle).
Bild von
einem Kraftwerk mit Kühlturm, aus dem Dampf-Wolken quellen; im Inneren ist es wie in einer Dampfsauna. –
Die einzige
Aufgabe des Kühlturms ist: Energie-Entsorgung!

Bild-Quelle:
eigene Aufnahme vom Steinkohle-Kraftwerk Ibbenbüren
Einige
Kraftwerke haben keinen Kühlturm und betreiben die Energie-Entsorgung
unauffälliger aber ebenso fatal; sie nutzen das Wasser eines Flusses oder des
Meeres, um die überschüssige Wärme loszuwerden, sehr zum Leidwesen der Tier-
und Pflanzenwelt im Wasser.
Das nächste
Bild zeigt so ein Kraftwerk ohne Kühlturm: Hier wird die Energie im Fluss
(vorne im Bild) unsichtbar entsorgt.

Bild-Quelle: wikipedia > Grosskraftwerk_Mannheim
(„für freie Dokumentation veröffentlicht“)
Überall, wo
Wärme-Energie gebraucht wird (z.B. in jedem Haushalt), könnte diese weggeworfene Energie sinnvoll
verwertet werden. Mit der Wärme-Energie, die aus einem großen Kühlturm
entlassen wird, könnte man alle Wohnungen und Gebäude einer Großstadt beheizen.
Dazu wäre aber ein riesiges Wärme-Verteilungsnetz nötig, das niemand aufbauen
und finanzieren kann. Deshalb ist das Konzept der Großkraftwerke ungeeignet für ein effektives
Energie-Management.
Hinzu kommen noch die
Ewigkeitslasten der Großkraftwerke und des Bergbaus. Der Bau, Rückbau,
Wasserhaltung, Endsorgung und Endlagerung von Groß-Kraftwerken und Bergbau-Anlagen
verbraucht mehr Energie und Kosten, als durch die Strom-Produktion während der
Betriebszeit erwirtschaftet wurde (s.u.).
Technisch möglich ist es schon seit hundert Jahren,
die elektrische Energie vorrangig dort zu produzieren, wo Wärme gebraucht wird,
nämlich mit so genannten Blockheizkraftwerken
(Kraft-Wärme-Kopplung), die sich heutzutage jeder in der Größe einer
Waschmaschine anstelle eines Heizkessels in den Keller stellen kann.
Hier ein
uraltes BHKW, das mit Pflanzenöl läuft (Verkleidung abgenommen):

Bild-Quelle: wikipedia > Blockheiz- kraftwerk Urheber: Franko30
Damit produziert man beim Heizen
nebenbei elektrische Energie, die man selbst nutzen oder (gegen Vergütung) ins
Netz einspeisen kann. (Mit beliebigen gasförmigen und flüssigen Brennstoffen
kann man ein solches Mini-Kraftwerk betreiben.)
Inzwischen hat man sich auf die Tugend alter
Erfindungen besonnen und festgestellt, dass für den Betrieb eines Generators
konventionelle Motoren, wie sie in Fahrzeugen eingesetzt werden, gar nicht
unbedingt die beste Wahl sind; so gibt es immer mehr Mini-BHKW
mit Stirling-Motoren, die mit
besserem Wirkungsgrad und längerer Haltbarkeit punkten können. (Zur Optimierung
der Generator-Technik habe ich auch
in meinem Artikel über Elektro-Fahrzeuge
Stellung genommen).
Wenn der Wärmebedarf in
Haushalt und Industrie auf diese Weise gedeckt und gleichzeitig der elektrische
Strom ins Netz gespeist würde, wären die meisten Großkraftwerke überflüssig,
gleichzeitig würden die CO2-Emissionen
mindestens halbiert, und in Verbindung mit dem weiteren Einsatz
regenerativer Energien immer mehr reduziert. Die großen Energieversorger
könnten, anstatt neue Großkraftwerke zu bauen, viele kleine Blockheizkraftwerke
beim Verbraucher installieren und betreiben. Sie könnten sie auch zentral so
steuern, dass die einzelnen Blockheizkraftwerke vorrangig dann laufen, wenn der
Strom-Bedarf im Netz größer ist als das Angebot aus Wind- und Solar-Energie.
Gerade im Winter, wenn das Angebot an Solarstrom weitgehend ausfällt, könnte die
Kraft-Wärme-Kopplung beim Heizen die Energie-Lücke im Strommarkt schließen.
Dies ist eine kurzfristig realisierbare Alternative zu den noch fehlenden
Strom-Speichern. Neue Kraftwerke mit Kühltürmen sind jedenfalls
überflüssig und nicht zu verantworten.
Im Januar 2010 sagte der Vorstandsvorsitzende eines
großen Energieversorgungsunternehmens im Radio, dass man auch bei intensiver
Nutzung regenerativer Energien unbedingt die Großkraftwerke (einschließlich
Kernkraftwerke) weiter betreiben müsse, weil im Winter oft kein Wind weht und
die Solar-Anlagen mit Schnee bedeckt sind. Und als im Jahr 2011 nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima
deutsche Kernkraftwerke abgeschaltet werden sollten, wurde wieder über den
Neubau von Großkraftwerken mit Kühltechnik spekuliert, um - ausgerechnet im
Winter - den ausfallenden Nuklearstrom zu ersetzen, wenn es an Solar-Energie
mangelt. So ein Unsinn!!! Gerade im Winter könnten viele kleine
Blockheizkraftwerke den Bedarf an elektrischer Energie decken.
Der "Rückbau" und die
"Entsorgung" eines Kernkraftwerks offenbart das Missverhältnis von
Aufwand und Nutzen eines Großkraftwerks besonders deutlich, Beispiel
Kernkraftwerk Greifswald: Das AKW war 16 Jahre in Betrieb, bevor es 1990
abgeschaltet wurde; seit 1995 befindet es sich im Abriss. Damit werden die 1000
Mitarbeiter auch weiterhin noch sehr lange beschäftigt sein. Ein Endlager für
die zigtausend Tonnen hochradioaktiven Materials, die für Millionen Jahre
sicher eingelagert werden sollen, ist (weltweit) nicht in Sicht; aber die
Sicherheitsbehälter in den Zwischenlagern kommen schon jetzt an ihre Haltbarkeitgrenze. – Beispiel Steinkohlekraftwerk
Ibbenbüren: Bis zu seiner Stilllegung im Jahr 2021 war es 36 Jahre als eins der
modernsten Kohlekraftwerke in Betrieb und wurde mit der Kohle aus dem
Ibbenbürener Bergbau befeuert. Seit dem Ende der Kohleförderung werden neue
bergbauliche Großprojekte vorangetrieben, um die alten Schachtanlagen zu
stabilisieren und das aufsteigende Grundwasser zu reinigen und abzuführen.
Diese neuen Anlagen sollen auf ewig betrieben werden. – Das Ruhrgebiet ist
durch den Jahrzehntelangen Bergbau um 10 bis 30 Meter abgesackt; über 200
riesige Pumpen müssen nun zeitlich unbegrenzt laufen, damit die Großstädte
nicht unter Wasser stehen.
Seit vielen Jahren haben sich
Biogas-Anlagen im
Energie-Markt etabliert und genießen zu Unrecht einen guten Ruf in der
Gesellschaft der regenerativen Energien, ja sogar als CO2-neutral werden sie
manchmal beschrieben. Dies aber ist ein fataler Irrtum und zieht schwerwiegende Schäden
für die Umwelt und die Landwirtschaft nach sich (Einzelheiten siehe unter Biogas).
Auch das CCS-Projekt,
nämlich das CO2
aufzufangen und in
unterirdischen Depots zu lagern, ist ein fataler Irrweg. Erstens habe
ich gezeigt, dass man einen großen Teil der klimaschädlichen Abgase erst gar
nicht zu produzieren braucht, zweitens ist für die unterirdische Verklappung
ein beträchtlicher Energieaufwand nötig, der die Menge des entstehenden CO2
nochmals erhöht (man rechnet zur Zeit mit etwa 40 % zusätzlich!), und drittens
ist der Schadstoff ja nicht weg, wenn er unterirdisch eingelagert wird. Sehr
wahrscheinlich wird er über Kurz oder Lang wieder an die Erdoberfläche kommen
und den nachfolgenden Generationen weitere Probleme bereiten. Als man die Salzstöcke als Lagerstätte für
radioaktive Abfälle entdeckte, ging man davon aus, dass sie Tausende von
Jahren sicher und stabil blieben und das ideale Endlager für radioaktiven Müll
wären. Und was haben wir jetzt in der Asse?!. Der Salzstock hat nicht einmal 40 Jahre gehalten, und
jetzt weiß man nicht, ob und wie man die tausend Tonnen hochgefährlicher Stoffe
wieder herausholen kann, geschweige denn wohin damit. Die Kosten für die
Rückholung radioaktiver Abfälle und die Stilllegung der Schachtanlage Asse
werden auf vier bis sechs Milliarden Euro geschätzt. Sie sollen nicht durch die
Betreiber, sondern durch den Bund getragen werden. Es gibt bis heute weltweit
kein sicheres Endlager für radioaktive Abfälle, und trotzdem wird in großem
Stil weiter produziert. Nicht zuletzt wegen der hochgradigen Gefahr, die von
diesen Stoffen ausgeht, könnte sich diese verantwortungslose Vorgehensweise
eines Tages als größtes Verbrechen der Menschheitsgeschichte
herausstellen. Alle Kernkraftwerke sofort abzuschalten, selbst wenn es dadurch
zu Stromausfällen und Liefer-Engpässen kommt, wäre spätestens nach der
Nuklearkatastrophe von Tschernobyl
die einzige verantwortbare Antwort auf die ungelöste Endlager-Problematik
gewesen. (Hier finden Sie auch Erklärungen und weitergehende Information zum
Thema Radioaktivität
und CO2.)
An der Entwicklung von Kernfusions-Reaktoren zur
Energiegewinnung haben sich Wissenschaftler und Techniker weltweit schon
Jahrzehnte lang die Zähne ausgebissen und etliche Milliarden Euro oder Dollar
in den Sand gesetzt. Die Auffassung, dass bei dieser Technik keine
radioaktiven Abfälle entstehen, entbehrt jeglicher Sachkenntnis. Nur der
theoretisch beschriebene Akt der Kernschmelze von Wasserstoff-Atomen hört sich
so schön sauber an. In der Realität löst aber die in einem Fusionsreaktor
entstehende Strahlung so vielfältige unkontrollierbare Kernreaktionen aus, dass
hierbei ein ganzer Cocktail von radioaktiven Nebenprodukten entsteht, deren
Menge und Gefährdung den Abfällen aus vorhandenen Kernkraftwerken um nichts
nachsteht. Im Übrigen ist es völlig überflüssig und sinnlos, in neue
Großkraftwerke zu investieren, wie ich bereits oben ausgeführt habe. Die
bekannten und schon jetzt ausgereiften Techniken zur Nutzung regenerativer
Energiequellen und zur wirklich effektiven Nutzung konventioneller
Energiequellen führen schneller, kostengünstiger und ohne neue Risiken zu einer
radikalen Reduzierung der Emissionen und gefährlichen Abfälle! - Und dafür muss
man auch nicht in die Wüste gehen, wie Befürworter von DESERTEC meinten; nach deren Einschätzung kann man
z.B. in Nordafrika so viel mehr Energie von der Sonne gewinnen als hierzulande,
dass der Investitions- und Transport-Aufwand für die Errichtung von
Solar-Anlagen in der Wüste zur Energieversorgung in Deutschland gerechtfertigt
wäre. Dabei ist die Energie-Einstrahlung der Sonne pro Quadratmeter dort nur
etwa doppelt so groß wie hier! Mit anderen Worten, um die gleiche Menge regenerative
Energie hier in Deutschland zu ernten, ist nur ein Bruchteil des Aufwandes
erforderlich, der für das DESERTEC-Projekt notwendig
wäre. Und ob man angesichts der politischen Unruhen in Nordafrika seit 2011 das
Investitions-Risiko sowie die Transport-Probleme und -Abhängigkeiten wirklich
eingehen sollte, erscheint mir ebenso zweifelhaft.
Windkraft
kann noch viel mehr als bisher zur Grundversorgung beitragen, und es gibt zahlreiche
Standorte, die ohne Beeinträchtigung von Natur und Menschen genutzt werden
können (an den Meeresküsten, neben Autobahnen und Industriegebieten usw.). Im
Übrigen werden die Lärmbelästigung
und sonstige Beeinträchtigungen durch Windkraft-Anlagen maßlos übertrieben.
Jede Landstraße und jede Autobahn produziert einen permanenten und vielfach
höheren Schallpegel als ein Windrad, und meistens ist sogar der Wind in den
Zweigen oder Blättern der Bäume lauter. Das Märchen vom schädlichen Infraschall durch
Windräder hat zudem ungerechtfertigt schweren Schaden für die Akzeptanz der
Windenergie angerichtet. Erstens werden die hörbaren pulsierenden Geräusche,
die durch die Passage der Flügel am Mast entstehen, fälschlicherweise mit
Infraschall verwechselt, und zweitens ist der tatsächliche Infraschalldruck so
gering, dass er nicht wahrgenommen werden kann und im Gemisch aller anderen
Schall- und Infraschall-Quellen selbst in ruhiger Umgebung regelrecht
untergeht.


So
ist es ziemlich perfekt: Auf dem nachfolgenden Foto ist die nach Süden
ausgerichtete Dachfläche eines Wohnhauses vollständig mit Solarzellen für
Photovoltaik belegt. Auch das Dach einer Scheune eignet sich vorzüglich für die
Nutzung der Sonnenenergie.


Bild-Quelle:
eigenes Foto
Für ein
Wohnhaus wäre es allerdings energetisch noch günstiger, wenn ein kleiner Teil
der Fläche für die thermo-solare Energienutzung (Sonnenkollektoren) reserviert
würde, damit die Brauchwassererwärmung ohne Umwege direkt durch Sonnenenergie
erfolgen kann.
Für die Erwärmung des
Brauchwassers sind Solar-Thermische
Anlagen aus energetischer Sicht optimal. Die notwendigen Komponenten
(Sonnenkollektor, Speicher, Pumpe mit Steuerung) müssen zum Zweck der
Brauchwassererwärmung nicht besonders groß dimensioniert werden und sind damit
definitiv nicht zu aufwändig oder zu teuer (Komplett-Systeme deutlich unter
2000 Euro). Zwei Drittel des Brauchwasserbedarfs kann damit zuverlässig gedeckt
werden. Für die Nacherwärmung des restlichen Drittels stehen alle möglichen
Optionen offen und richten sich nach den örtlichen Gegebenheiten. Ich plädiere
generell für eine vollständige Abkopplung vom Raumheizungssystem, damit die
Heizung im Sommer komplett abgeschaltet werden kann. Speziell für diesen Zweck
empfiehlt sich eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Speicher (ebenfalls deutlich
unter 2000 Euro).
Statt mit Sonnenkollektoren
auch die Raum-Heizung zu unterstützen, ziehe ich die effektivste und
gleichzeitig billigste Solarheizung vor, nämlich große (gut isolierte) Fenster
an der Südseite des Hauses, die im Winter nicht beschattet werden - so wie auf
dem obigen Bild. Aus Jahrzente-langer Erfahrung weiß
ich, wie gut die solare
Direkt-Heizung funktioniert. Selbst an sehr kalten Tagen bleibt unsere
Heizung abgeschaltet, solange nur die Sonne scheint, nämlich durch große Fenster auf der Südseite
direkt in die Räume. Welch ein Unsinn wäre es, wenn wir die Sonnen-Energie in
Kollektoren sammeln, mit Pumpen in den Speicher und von dort in den
Heizungskreislauf beförderten und dabei Verluste und Energie-Verbrauch
hinnehmen müssten (genau das aber wird finanziell gefördert!). Ein solch
technisch aufwendiger Umweg ist nur dort zu rechtfertigen, wo es keine
Möglichkeiten der solaren Direktheizung gibt! Wenn es möglich ist, die
Sonnenwärme direkt in die Wohnung zu lassen, ist es auch unsinnig, eine
Wärmepumpe mit selbst erzeugten Solarstrom zu
betreiben. Denn wenn die Sonnenstrahlung nicht reicht, um das Brauchwasser und
die Räume direkt mit Hilfe eines Sonnenkollektors aufzuheizen, reicht auch der
Solarstrom nicht für den Betrieb einer Wärmepumpe.
Pufferspeicher für die
Heizung, die vom (thermischen) Sonnenkollektor geladen werden, halte ich
generell für wenig sinnvoll; denn gerade im Winter erreicht der Kollektor selten
mehr als 25 oder 30 Grad und kann so keinen nennenswerten Beitrag für die
Heizungs-Anlage liefern. Im Sommer hingegen, wenn der Kollektor bei sonnigem
Wetter mehr Wärme-Energie liefert als für die Warmwasserbereitung benötigt
wird, braucht man auch keine Heizung.
Bei dieser Gelegenheit möchte
ich die Notwendigkeit hervorheben, eine Initiative ins Leben zu rufen, damit
Bebauungs-Pläne, Bauvorschriften,
Architekten-Richtlinien usw. so ausgestaltet werden, dass in allen Gebäuden die
Solar-Energie optimal genutzt werden kann (z.B. Dachneigung nach Süden, Fenster
vorrangig auf der Südseite usw.). –
Tipps für sparsamen und verschleißarmen
Heizungs-Betrieb:
 Beim Bau unserer
Heizungsanlage im Jahr 1980, einer Wärmepumpe mit Flächenkollektor im Erdreich,
wurde ein Pufferspeicher installiert, angeblich zur Überbrückung der
Strom-Abschalt-Zeiten im Wärmepumpen-Tarif; den Pufferspeicher habe ich aber
schon nach wenigen Jahren stillgelegt, ganz einfach weil die Fußbodenheizung
viel mehr (und damit reichlich genug) Wärme speichert, und ein überflüssiger Pufferspeicher
gravierende Wärmeverluste mit sich bringt. Nachdem ich dann auch die Steuerung
durch einen simplen Eigenbau ergänzt habe, läuft unsere Anlage wesentlich
ausgeglichener und sparsamer.
Beim Bau unserer
Heizungsanlage im Jahr 1980, einer Wärmepumpe mit Flächenkollektor im Erdreich,
wurde ein Pufferspeicher installiert, angeblich zur Überbrückung der
Strom-Abschalt-Zeiten im Wärmepumpen-Tarif; den Pufferspeicher habe ich aber
schon nach wenigen Jahren stillgelegt, ganz einfach weil die Fußbodenheizung
viel mehr (und damit reichlich genug) Wärme speichert, und ein überflüssiger Pufferspeicher
gravierende Wärmeverluste mit sich bringt. Nachdem ich dann auch die Steuerung
durch einen simplen Eigenbau ergänzt habe, läuft unsere Anlage wesentlich
ausgeglichener und sparsamer.
Wesentliche Gesichtspunkte
der vereinfachten
Regelung sind:
1. Anforderung der Heizung
durch einen unabhängigen RaumThermostaten mit einer Schalt-Hysterese
von 0,2 Grad. (Die resultierende Raumtemperatur-Schwankung stört überhaupt
nicht!)
Das Ziel des zusätzlichen Thermostaten ist so
simpel wie logisch: Wenn
es in der Wohnung warm genug ist, soll die Heizung nicht laufen. Der
„unabhängige“ Thermostat entzieht also der Wärmepumpe einfach die
Betriebserlaubnis („Freigabe“), ebenso wie bei der „manuellen Abschaltung“
unter Punkt 3.
Es ist unglaublich, aber Tatsache: Auch neue
Heizungs-Steuerungen lassen (trotz zahlloser Parameter-Einstellmöglichkeiten)
diese naheliegende Regelung nicht zu, selbst bei
Einstellung des maximalen „Raumeinflusses“.
– Wichtig ist es, den Temperatur-Sensor des
Raumthermostaten dort anzubringen, wo er von punktuellen Ereignissen (wie
Luftzug oder Sonneneinstrahlung) nicht beeinflusst werden kann. Deshalb habe
ich ihn in den Hohlraum einer Trennwand im Wohnbereich gesetzt.
2. Nach jeder Abschaltung 2
Stunden Wartezeit,
bevor die Heizung wieder anspringt.
3. (optional:) Möglichkeit
der manuellen
Abschaltung/Unterbrechung, weil man als Mensch vorausschauen kann, das kann
keine Elektronik. Wenn es beispielsweise morgens etwas kühl in der Wohnung ist,
aber man absehen kann, dass die Sonne schon bald ins Wohnzimmer scheint, dann
braucht die Heizung nicht anzuspringen.
Die Maßnahmen 1 und 2 führen
zu einer äußerst ruhigen Taktung
der Wärmepumpe, d.h. die Heizung springt nur selten an, läuft dann aber länger
und effizienter. Dies kommt der Haltbarkeit und Wirtschaftlichkeit
der Heizungsanlage zu Gute und ist insbesondere für eine Wärmepumpe äußerst
sinnvoll, ebenso wie für ein BHKW.
Eine willkommene
Nebenerscheinung unserer Wärmepumpe ist die Möglichkeit der Kühlung im Sommer,
quasi eine integrierte Klima-Anlage. ABER: Wir machen nur von der passiven (!!) Kühlung Gebrauch, zu deren
Nutzung nur zwei sehr sparsame Umwälzpumpen zeitweise laufen müssen. Dabei wird
die Wärme aus dem Wohnraum über einen Wärmetauscher ins Erdreich gepumpt. Diese
Art der fast kostenlosen Kühlung ist vollkommen ausreichend und kann mit gutem
Gewissen genutzt werden, zumal die Erwärmung des Erdreichs dem Heizbetrieb im
Winter zugute kommt – zwar nur in geringem Ausmaß, aber immerhin nicht
nachteilig!
Eine ebenso eindeutige
Empfehlung kann ich für eine zentrale
Lüftungsanlage mit Wärme-Rückgewinnung geben (linkes Bild): Sie sorgt
selbständig für ununterbrochene Frischluft-Zufuhr in optimaler Menge und
vermeidet mit Hilfe eines Wärmetauschers die enormen Wärme-Verluste, die man
bei manuellem Lüften durch Öffnen der Fenster hinnehmen muss. Das ist sehr
komfortabel und Energie-sparend zugleich. Die für den
Betrieb notwendige elektrische Energie ist minimal im Vergleich zur Einsparung
der Heiz-Energie-Verluste
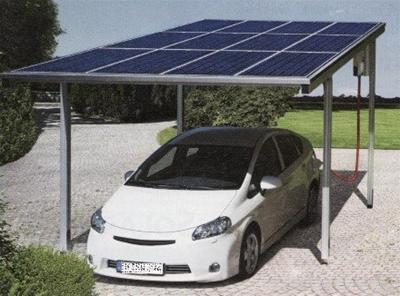
… Und so geht’s auch:
Ein Carport
kann mehr bieten als nur Wetterschutz (auch wenn man kein Elektroauto hat)!
(Bild-Quelle:
Kundenzeitschrift des Energieversorgers RWE)
Nahziele für die Sonnen-Energie-Nutzung:
-
Sonnenkollektoren zur Brauchwasser-Erwärmung und Photovoltaik zur
Stromerzeugung auf allen (geeigneten) Dächern;
- Bauvorschriften
an der Optimierung der Solarenergienutzung orientieren;
-
Solarzellen sollten als Universal-Dacheindeckung Normalität werden; auch
Auto-Dächer könnten die Solar-Energie nutzen.
Windmühlen falsch herum?
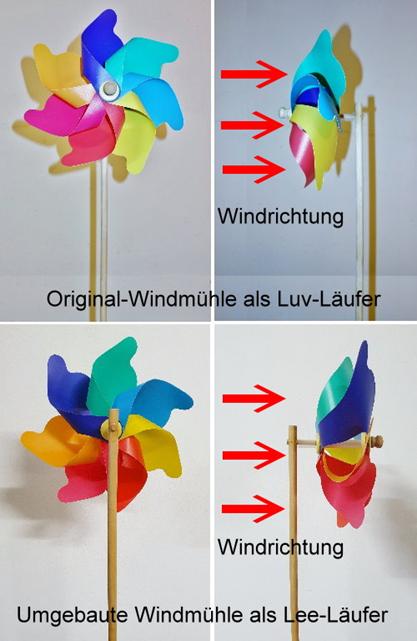 Bei den meisten
Windkraft-Anlagen handelt es sich um Luv-Läufer, d.h. der Rotor ist - aus der Windrichtung betrachtet
- vor dem Mast
angeordnet. So sehen auch in aller Regel die kleinen Windmühlen aus, die man
als Kinder-Spielzeug kaufen kann. Stellt man diese so draußen auf, dass sich der
Stiel frei drehen lässt, damit die Windmühle immer optimal vom Wind angeblasen
wird, passiert genau das Gegenteil: Sie dreht sich immer "weg". - Am
besten läuft so eine Windmühle, wenn der Wind auf die offene Rotorseite trifft.
Da der Rotor aber vom Wind wie eine Fahne hinter den Mast gedrückt wird, kehrt
er dem Wind den Rücken; so wird der Rotor von der geschlossenen Seite
angeströmt und taumelt unkontrolliert hin und her. Deshalb habe ich bei der
links abgebildeten Windmühle den Rotor umgedreht und auf diese Weise einen Lee-Läufer (unten)
geschaffen, der vom Wind automatisch
optimal ausgerichtet wird, da er in der Fahnen-Position (also hinter dem
Mast) von der offenen Seite angeströmt wird. Ich frage mich, warum die Spielzeug-Windmühlen
nicht gleich richtig herum gebaut und angeboten werden!
Bei den meisten
Windkraft-Anlagen handelt es sich um Luv-Läufer, d.h. der Rotor ist - aus der Windrichtung betrachtet
- vor dem Mast
angeordnet. So sehen auch in aller Regel die kleinen Windmühlen aus, die man
als Kinder-Spielzeug kaufen kann. Stellt man diese so draußen auf, dass sich der
Stiel frei drehen lässt, damit die Windmühle immer optimal vom Wind angeblasen
wird, passiert genau das Gegenteil: Sie dreht sich immer "weg". - Am
besten läuft so eine Windmühle, wenn der Wind auf die offene Rotorseite trifft.
Da der Rotor aber vom Wind wie eine Fahne hinter den Mast gedrückt wird, kehrt
er dem Wind den Rücken; so wird der Rotor von der geschlossenen Seite
angeströmt und taumelt unkontrolliert hin und her. Deshalb habe ich bei der
links abgebildeten Windmühle den Rotor umgedreht und auf diese Weise einen Lee-Läufer (unten)
geschaffen, der vom Wind automatisch
optimal ausgerichtet wird, da er in der Fahnen-Position (also hinter dem
Mast) von der offenen Seite angeströmt wird. Ich frage mich, warum die Spielzeug-Windmühlen
nicht gleich richtig herum gebaut und angeboten werden!
Diese Problematik ist
natürlich auch beim Bau von Windkraft-Anlagen zu beachten. Damit die Luv-Läufer
immer optimal zum Wind stehen, werden die Rotoren von dem aktiven Windnachführungsmechanismus
immer vor den Mast gedreht. Versuche mit Lee-Läufern ohne Windnachführung
offenbarten Probleme mit Schwingungen und Taumel-Bewegungen. Störende
Turbulenzen und die damit verbundenen Geräusche und Energieverluste durch die
Passage der Rotorblätter am Mast dürften in beiden Fällen gleichermaßen
auftreten, egal ob der Mast vor oder hinter dem Rotor steht. Deshalb sollte man
meiner Meinung nach mal Lee-Läufer
mit
Windnachführung testen und weiter entwickeln, weil die Windnachführung
des Rotors in Fahnen-Position (also hinter dem Mast) sicher mit geringerem
Energie-Aufwand erfolgen kann, da dies die "natürliche" Position des
Rotors ist.
Rettung-der-Erde.de >>> zur Startseite <<<
Zwei-Liter-Auto - Generator-Elektrischer Antrieb
Geschenkte Energie: Energieversorgung
- CO2 Emission halbieren
Faszinierendes Wissen - endlich
kapiert: CO2-Haushalt - Energie - Radioaktivität - große Zahlen - Strom / Spannung
Ungeschminkte Wahrheit: Fehlentwicklungen / Umweltprobleme - Wege aus der Krise
Links / Favoriten
- Kontakt /
Impressum